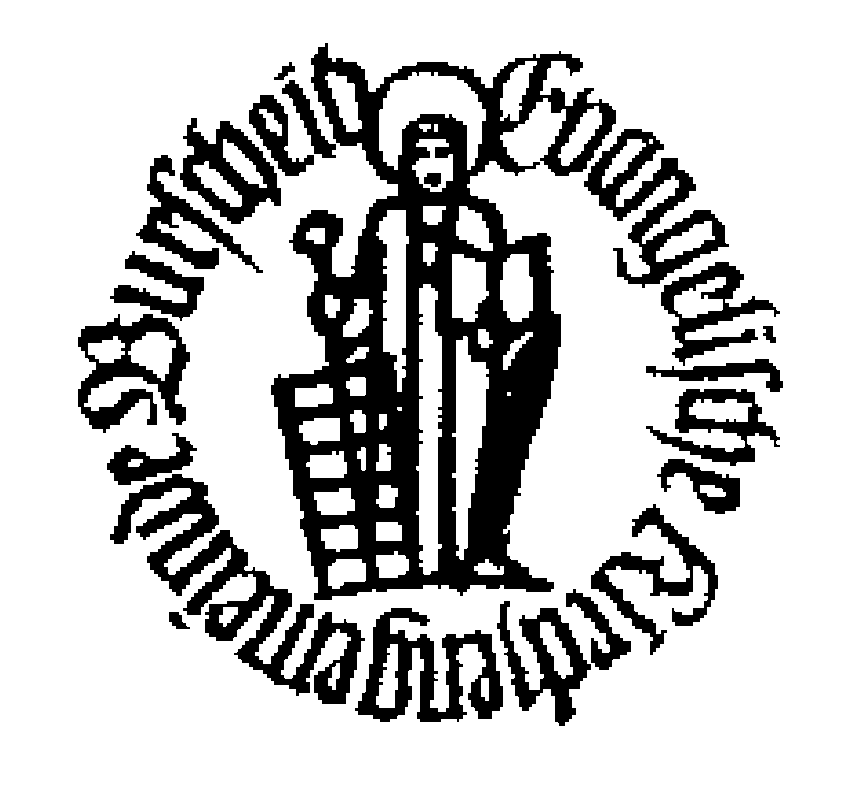Evangelische Kirchengemeinde Burscheid
„Du musst vor Ort das Beste machen, was möglich ist“

Kirchenmusikdirektorin Silke Hamburger, seit 25 Jahren Kantorin der Burscheider Gemeinde, über gewonnene Einsichten, verpasste Absprünge und den schrittweisen Neuanfang nach Corona.
In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz nahe dem Kurfürstendamm hatte Silke Hamburger als Studentin der Berliner Kirchenmusikschule am Neujahrstag 1988 ihren ersten Gottesdienst gespielt. Hier hatte sie auch im Jahr darauf am Abend nach dem Mauerfall an der Orgel gesessen. Aber zum 1. Juli 1996 folgte der Umzug von der Hauptstadt in die Kleinstadt. Inzwischen währt ihr kirchenmusikalisches Berufsleben in Burscheid schon ein Vierteljahrhundert. Geplant war das nicht.
Was hat eine 30-jährige Kirchenmusikerin vor 25 Jahren dazu bewogen, für ihre erste Festanstellung von Berlin nach Burscheid zu wechseln?
Drei Gründe. Der erste: In Berlin gab es keine Stellen, sondern seit 1993 einen Stellenstopp. Das lag an den finanziellen Folgen der Wende. In der Gedächtniskirche hatte ich zwar genug zu tun und auch einen guten Verdienst, aber keinen Anstellungsvertrag. Und ich wollte eigenverantwortlich eine Stelle übernehmen und selbst bestimmen, was ich tue. Der zweite Grund: Ich komme aus der rheinischen Landeskirche und bin hier über Generationen familiär verwurzelt. Und der dritte Grund war schlicht, dass mich Burscheid bei all meinen Bewerbungen damals aus irgendeinem Grund angelacht hat. Die erste Stelle muss eigentlich so sein, dass du dich zeigen kannst, aber irgendwann auch wieder wegkommst. Bei meinem ersten Besuch in Burscheid habe ich gedacht: Hier ist irgendwas in Ordnung. Als ich wieder zurück in meine Berliner Stammkneipe kam, habe ich gesagt: Das ist die Stelle, die ich haben will.
Und was hat dich dazu bewogen, dann 25 Jahre zu bleiben?
Ich dachte, ich habe hier drei bis fünf Jahre meine Lehrzeit und dann muss ich den Absprung bekommen. Die Burscheider Orgel klingt gut, aber sie ist klein und ich kann vieles nicht spielen. Auch der Chor war damals nicht in dem Zustand, von dem man träumt, wenn man eine A-Prüfung hinter sich hat. Aber nach drei bis fünf Jahren fing die Sache gerade an, richtig Spaß zu machen. Die Klangwege rollten an, der Chor wuchs, der Kulturverein nahm die Arbeit auf. Also habe ich keine Stellenanzeigen gelesen. Ein paar Jahre später habe ich mich dann aus Vernunftsgründen beworben, aber auf die Frage, warum ich aus Burscheid weg will, immer geantwortet: Ich will gar nicht weg. Mit einer solchen Antwort hat man natürlich keine Chance. Dazu kommt die bis heute anhaltend gute Stimmung innerhalb des gesamten Teams. Damit wurde ein Wechsel immer schwerer. Und als der Moment kam, an dem ich wusste, ich muss jetzt weg, sonst bin ich zu alt, wurde die Krankheit meines Mannes so gravierend, dass ein Umzug ausgeschlossen war. Irgendwann fragt man sich dann, was wirklich wichtig ist: Ich gehe hier noch immer gerne in die Kirche, ich gehe nach all den Jahren noch immer gerne in jede Dienstbesprechung.
Was sind die Vorteile einer Kirchenmusikerstelle in einer Kleinstadt?
Dass man hier nicht nur Kirchenmusikerin einer Gemeinde ist, sondern der ganzen Stadt. Die Wahrnehmung dessen, was man tut, und die Vernetzung mit den außergemeindlichen Akteuren sind viel intensiver als in einer Großstadt mit ihrem enormen Kultur- und Freizeitangebot.
Wenn du aus den 25 Jahren in Burscheid drei besondere musikalische Glücksmomente herausgreifen müsstest, welche wären das?
Mein Professor an der Hochschule hat immer gesagt: Es ist egal, wo ihr buddelt, ihr müsst gut buddeln, unabhängig davon, wo es euch hinwirft. Die Befriedigung ist letztlich, vor Ort das Beste zu machen, was möglich ist. Du musst die, die vor dir sitzen, eine Stufe weiterbringen. Daher ist natürlich die Matthäus-Passion von Bach das Erste, das mir einfällt. Mit zwei Laienchören und ohne tatsächliche Aushilfen ein solches Werk hinzubekommen, fand ich eine große Leistung der Sängerinnen und Sänger. Das hätte ich vor 25 Jahren im Traum nicht gedacht. Daneben gibt es zwei Highlights, die auch verdeutlichen, warum ich immer noch gerne hier bin. Das ist zum einen Musik und Rezitation. Ich komme vom Klavier und kann das in dieser Gemeinde ausleben, weil sie auch ein solches Angebot als Kirchenmusik akzeptiert und genießt. Und entsprechend ist für mich das andere Highlight das Café Nostalgie. Dieses Jahr ist wegen Corona das erste Jahr seit 1999 ohne Café Nostalgie und ich wusste überhaupt nicht, was ich am Karnevalssonntag machen sollte – eine Katastrophe.
Das sind ja auch schlechte Zeiten, um ein Dienstjubiläum zu feiern. Sorgst du dich um die Chor- und Kirchenmusik nach Corona?
Nein, die Menschen werden dann hungrig sein. Es gibt zwar überall die Angst, dass die Chöre auseinanderbrechen und die Leute wegbleiben nach der langen Pause. Aber wo sollen sie denn hin? Es gibt ja nichts. Wenn sie singen wollen, können sie es derzeit schlicht nicht. Das ist bei den Kindern vom Matthäus-Chörchen genauso. Ich hatte gedacht, das kannst du vergessen, nach einem halben Jahr sind die weg. Aber stattdessen schicken sie mir ein Video mit einem Ständchen für mich. Ich fange nach Corona wieder da an, wo wir zu dem Zeitpunkt stehen. Natürlich hast du nach zwei Jahren nicht mehr den Chor wie zuvor. Singen ist ja wie eine sportliche Betätigung. Ein 100-Meter-Läufer, der zwei Jahre nicht trainiert, ist auch nicht mehr so schnell wie vorher. Aber so ist es eben.
Kannst du schon sagen, was deine musikalischen Pläne für die Zeit nach Corona sind?
Für die Zeit, wenn es ganz durchgestanden ist – keine Ahnung, weil ich nicht weiß, was ich dann vorfinde. Die Klangwege wird es wieder geben, ich will auch in diesem Jahr eine CD-Aufnahme mit der Orgel machen. Im Moment beschäftigt mich eher die Frage, wie ich die Kirchenmusik bis dahin am Laufen halte. Wir haben uns mit der Kantorei Anfang Februar zum ersten Mal wieder in einer Videokonferenz für einen Vortrag getroffen. Ich war überrascht, wie gut das ankam. Wir werden sicher zunächst mit kleinen Ensembles beginnen wie im vergangenen Sommer schon. Es wird nicht den Tag geben, an dem wir sagen können: Jetzt ist alles wieder wie früher. Sondern es wird sich schrittweise entwickeln. Das Gleiche gilt für die Instrumentaldinge und das Matthäus-Chörchen. Was möglich ist, wird angeboten.
Wenn es um die Entwicklung der Kirche geht, ist immer wieder von Verschlechterungen und Abbrüchen die Rede. Fällt dir etwas ein, das sich in deinem Arbeitsfeld positiv verändert hat seit deiner Anfangszeit hier?
Da muss man unterscheiden zwischen meinem Arbeitsfeld hier vor Ort und dem Blick auf meinen Arbeitsbereich im Allgemeinen. Hier vor Ort ist es immer besser geworden. Die Unterstützung ist riesig und wird eher noch größer. Solange du hier nicht nur auf deiner Orgelpfeife sitzt und herabguckst, sondern dich einbringst in die Gesamtgemeinde, hast du eine hohe Akzeptanz. Und den Menschen ist inzwischen bewusster, was sie an der Kirchenmusik haben, gerade weil sie nicht mehr so selbstverständlich und immer verfügbar ist. Das sieht man auch an der positiven Entwicklung der Kooperationsbereitschaft. Die Gesamtschau auf die Kirchenmusik sieht nicht so positiv aus. Uns fehlt der Nachwuchs, es gibt zu wenige Studierende, sodass der Durchschnitt zu schwach ist.
Wie wird sich die Kirchenmusik an die veränderte Situation anpassen müssen?
Wir werden nicht alle weiter alles und das auch noch besonders gut machen können. Populäres und klassisches Kirchenmusikverständnis müssen gleichwertig nebeneinanderstehen. Wir müssen die Menschen, die zu uns kommen, mit dem bedienen, womit sie uns auch verstehen. Dazu könnte es in den Gemeinden eines Kirchenkreises unterschiedliche Schwerpunkte für die einzelnen Ausrichtungen geben. Die Gemeinden müssen dann aber auch akzeptieren, dass man vor Ort nicht mehr alles bekommt, sondern vielleicht fahren muss, wenn man einen Kinderchor für seine Kinder sucht oder die Matthäus-Passion singen möchte. Wir dürfen aber auch nicht nur darauf schielen, womit wir bei den Leuten ankommen, sondern müssen auch unseren Angeboten vertrauen.

Man weiß nie, was passiert, aber wäre es für dich ein befremdlicher Gedanke, dein Berufsleben in Burscheid begonnen zu haben und auch zu beenden?
Nein, befremdlich ist der Gedanke nicht. Ich weiß nur noch nicht, ob er sich auch gut anfühlt. Aber wenn nicht irgendwelche Wunder geschehen, wird es so sein und es hätte wirklich schlimmer kommen können (lacht). Man ist vielleicht nie ganz glücklich und zufrieden da, wo man gerade ist, weil man immer denkt, woanders könnte es noch schöner sein. Und zugleich weiß man, dass das völliger Blödsinn ist. Aber wenn man diesem Gedanken, an anderer Stelle könnte alles noch ein bisschen besser sein, nicht ab und an nachhängt, hat man bekanntlich die Karrierestufe erreicht, auf der man überfordert ist und eigentlich nichts mehr zu suchen hat.
Interview und Fotos: Ekkehard Rüger